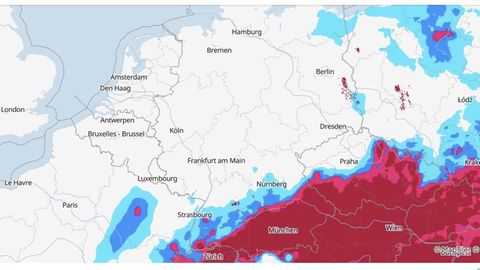1998 wurden die Tabakkonzerne im Zuge der großen Schadensersatzprozesse von US-Gerichten dazu gezwungen, ihre gesamten internen Dokumente öffentlich zugänglich zu machen. Auf Seiten wie www.tobaccodocuments.org oder www.legacy.library.ucsf.edu kann jeder in den insgesamt 40 Millionen Seiten stöbern.
Thilo Grüning von der London School of Hygiene & Tropical Medicine hat mit einigen Kollegen die Dokumente systematisch ausgewertet und untersucht. Dabei fand er Beweise dafür, wie die Tabakindustrie hochrangige deutsche Ärzte und Wissenschaftler über Jahrzehnte hinweg mithilfe von Geld zu ihren Gunsten beeinflusst und die Forschung manipuliert hat.
Die Ergebnisse sind erschreckend: Führende Köpfe in Medizin und Forschung standen über Jahre hinweg auf den Gehaltslisten der Tabakkonzerne. Von 1950 an baute die Tabakindustrie ein Netzwerk von Forschungsinstitutionen und Wissenschaftlern auf, die finanziell von ihr abhängig waren. Im Gegenzug verschleierten und manipulierten diese Wissenschaftler jahrzehntelang Erkenntnisse über die Gefährlichkeit des Rauchens und lieferten zahlreiche tendenziöse Gegenstudien, die das Rauchen als harmlos darstellten.
Herr Grüning, was schätzen Sie, wie viele deutsche Wissenschaftler standen oder stehen noch unter dem Einfluss der Tabakindustrie?
Wir haben über 60 Namen gefunden, wahrscheinlich sind es aber noch viel mehr. Bei 40 Millionen Seiten muss die Suche natürlich lückenhaft bleiben. Dazu kommt, dass die Dokumente der British American Tobacco, die auch sehr aktiv in Deutschland ist, nicht im Internet verfügbar sind. Alleine in den letzten Tagen habe ich von verschiedener Seite von weiteren Wissenschaftlern erfahren, die involviert gewesen sein sollen.
Außerdem hat nach der Veröffentlichung 1998 die Tabakindustrie ihre Kommunikationswege verändert. Alles was danach kam, ist im Internet nicht mehr unbedingt zugänglich.
Wieso haben Sie nicht einfach die Namen aller bestochenenen Wissenschaftler veröffentlicht?
Wir wollten keine Hexenjagd beginnen. Es geht uns darum, die systematische Einflussnahme auf die Wissenschaftler und wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschreiben. Wir wollten, dass das aufhört. Und das erreicht man nicht, indem man Einzelne an den Pranger stellt.
Trotzdem haben wir einige der schlimmsten Beispiele genannt. Einfach, um dem Leser deutlich zu machen, dass es sich hier um sehr bedeutende Wissenschaftler handelt.
Mit anderen Worten: Die, die Sie genannt haben, sind auch die Schlimmsten?
Ja, das kann man so sagen. Wobei es natürlich noch mehr schlimme Fälle gegeben hat. Die Bandbreite der Einflussnahme war groß: Es gab Wissenschaftler, die vielleicht nur einmal in ihrem Leben und nur wenig finanzielle Mittel in Anspruch genommen haben, bis hin zu Forschern, die ihre gesamte Karriere darauf aufgebaut haben.
Welche Reaktionen gab es auf Ihre Veröffentlichung?
Es gab eine Stellungnahme des VdC [Verband Deutscher Cigarettenindustrie, Anm. d. Red.], die alles leugnete. In keinster Weise fand dort eine Auseinandersetzung mit unserer Arbeit statt. Von betroffenen Wissenschaftlern gab es bislang keine Reaktion, allerdings seitens der sehr interessierten Presse sowie von Wissenschaftlern und Ärzten, die schockiert und empört über diese Vorgänge in Deutschland sind.
Denken Sie, dass das vorher alles noch nicht bekannt war?
Viele Vorgänge wird man geahnt haben, der Eine oder Andere vielleicht auch gewusst. Einige betroffene Wissenschaftler haben ja auch öffentlich zugegeben, mit der Tabakindustrie zusammenzuarbeiten. Was man aber wohl nicht wusste war, wie tief greifend der Einfluss der Tabakindustrie auf die Wissenschaft war.
40 Millionen Seiten - wie haben Sie diesen Wust an Information durchsucht? Haben Sie einfach alle prominenten Wissenschaftler durchprobiert?
Nein, dafür braucht man ein relativ systematisches Vorgehen. Im Englischen bezeichnet man diese als "iterative approach": Man beginnt mit der Suche erst sehr breit, also beispielsweise mit dem Suchbegriff "Forschung*" oder "research*" . Man erhält dann natürlich erst einmal eine riesige Anzahl an Suchtreffern und beginnt in einigen Dokumenten zu lesen, zum Beispiel in Strategiepapieren, Protokollen, etc. Dort stößt man auf Namen, Vorgänge, neue Begriffe. So arbeitet man sich vor. Letztlich ist es die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Gab es ähnliche Untersuchungen auch für andere Länder?
Ja, es gibt vergleichbare Untersuchungen für die USA und Australien - mit ähnlichen Resultaten. Allerdings scheint Deutschland für die Tabakindustrie einer der bevorzugten Standorte für solche Aktivitäten gewesen zu sein.
Fürchten Sie angesichts dieser ganzen Vernetzungen, dass man Ihnen beruflich womöglich Steine in den Weg legen könnte?
Ich habe keine große Angst. Die Wissenschaftler oder Personen, die aus diesen Gründen eine Zusammenarbeit mit mir ablehnen, sind auch zugleich diejenigen, mit denen ich nicht unbedingt zusammenarbeiten möchte. Viele begegnen mir sehr zustimmend - international und in Deutschland.
Beschimpfungen oder Bedrohungen kämen ohnehin zu spät - die Sachen sind jetzt veröffentlicht. Drohungen würden der ganzen Sache ohnehin auch nur noch mehr Aufmerksamkeit bringen.
Wieso erscheint eine Studie über den Einfluss der Tabakindustrie auf deutsche Wissenschaftler im American Journal Of Public Health [APJH, Anm. d. Red.] und nicht in einem deutschen Fachmagazin, wie zum Beispiel dem Deutschen Ärzteblatt?
Das AJPH ist ein relativ gutes und angesehenes Journal im medizinischen Bereich. Damit erhält die Arbeit auch eine viel größere Bedeutung, als wenn ich sie in einer deutschen Zeitschrift veröffentlicht hätte.
Wurde Ihr Artikel von deutschen Zeitschriften abgelehnt?
Nein, ich habe ihn deutschen Zeitschriften gar nicht erst angeboten. Ein Teil dieser Journale wird entweder herausgegeben, oder von einem wissenschaftlichen Beirat beraten, in dem Wissenschaftler sitzen, die von der Tabakindustrie bezahlt werden. Es hätte wenig Sinn gemacht, dort meine Arbeit anzubieten... Die Einflussnahme der Tabakindustrie auf deutsche Journale ist sehr groß.
Die Tabakindustrie hat sich im VdC organisiert, von dem aus die Wissenschaft systematisch beeinflusst wurde...
Ja, aber nicht nur vom VdC aus. Der VdC ist eine Interessenvertretung der Zigarettenindustrie in Deutschland. Parallel zum VdC haben die einzelnen Tabakfirmen auch in Eigenregie Forschungsprogramme in Deutschland organisiert.
Normalerweise stehen die Tabakkonzerne in Konkurrenz zueinander. Doch anscheinend gab es die Einsicht, dass man gemeinsam besser seine Ziele durchsetzen kann. Das erinnert an Mafia-Filme, wo sich die Paten verschiedener Familien gezwungenermaßen an einen Tisch setzen. Kann man diese Vernetzung schon mafiös nennen?
Die Idee ist nahe liegend, insbesondere wenn man über Dinge liest, die man nicht in den veröffentlichten Dokumenten findet, zum Beispiel Schmuggelaktivitäten der Tabakindustrie. Aber darüber weiß ich zu wenig.
Mafiös? Ich würde es eher eine Extremform der Interessenvertretung nennen. Die Tabakkonzerne haben erkannt, dass die abnehmende soziale Akzeptanz des Rauchens ihre Existenzgrundlage gefährdet. Entsprechend aktiv haben sie sich in dieser gemeinsamen Zielsetzung zusammengeschlossen: Wie kann man verhindern, dass die Menschen begreifen, wie tödlich das Produkt ist, das wir verkaufen?
Deutschland hat im europäischen Vergleich mit die laxeste Gesetzgebung in Sachen Tabakkontrolle, die gesellschaftliche Akzeptanz ist hoch - im Vergleich beispielsweise zu Italien, Irland und England, wo mittlerweile Rauchverbot in öffentlichen Bereichen besteht. Die Raucherrate deutscher Männer ist die zweithöchste nach Griechenland, jährlich sterben Schätzungen zufolge hierzulande bis zu 140.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.
Eine neue Studie spricht sogar von 3300 Toten jährlich infolge des Passivrauchens. Stellen Sie sich nur mal vor, man würde heute ein Genussprodukt auf den Markt bringen, das pro Jahr 3300 Leute tötet, die es noch nicht einmal selbst konsumieren! Nach den ersten drei Todesfällen würden die Hersteller sofort ins Gefängnis wandern. Das ist einfach unvorstellbar.
Deutschland ist zudem einer der stärksten Absatzmärkte der Tabakindustrie - glauben Sie, dass nicht noch weitere Faktoren - Politik, Medien - mit im Spiel gewesen sein müssen?
Sie haben völlig Recht. Die Einflussnahme auf die Wissenschaftler ist ein - wenn auch sehr bedeutsames - Beispiel für die Einflussnahme der Tabakindustrie auf die Gesellschaft insgesamt. Zu diesen Strukturen zählen selbstverständlich auch eine sehr große Beeinflussung von Politikern - auch dafür findet man Beispiele in den Tabakdokumenten - , Einflussnahme auf die Medien, insbesondere die Presse, sowie die Abhängigkeit der Presse von den Anzeigeneinnahmen durch die Tabakindustrie.
Gibt es eine Möglichkeit die Verstrickungen mit der Politik aufzudecken? Sie vermuten, dass diese Dokumente nicht vollständig veröffentlicht wurden.
Es gibt sicherlich Vorgänge, die dort verzeichnet sind. Wer die Zeit hat und sich da dran setzen möchte, der wird fündig werden. Ich kann es nur empfehlen.
Bei Ihrer Untersuchung haben Sie diese Frage allerdings außen vor gelassen.
Ich habe es nebenbei ein bisschen mitgemacht, aber nicht als Bestandteil meiner Studie.
Welchen Einfluss hat die Tabakindustrie heute noch auf die Wissenschaft? Der seinerzeit gegründete "Forschungsrat Rauchen und Gesundheit" existiert nicht mehr, die Stiftung "Verum" ["Stiftung für Verhalten und Umwelt", Anm. d. Red.] ist die Nachfolgeorganisation. Agiert diese noch genau so wie damals der "Forschungsrat"?
Wir wissen viel weniger über gegenwärtige Vorgänge, schlicht und einfach, weil sie nicht mehr in den Dokumenten erscheinen. Es gibt aber keinerlei Gründe anzunehmen, dass sich grundsätzlich etwas verändert hat. Ich weiß, dass auch "Verum" Forschung betreibt, die von den Gesundheitsschäden durch Rauchen ablenken soll, die andere Ursachen für Krebs aufzeigen will.
Handystrahlung zum Beispiel?
Ein Klassiker, ja. Dann habe ich in meiner Studie noch das Inbifo (Institut für Biologische Forschung) genannt, das damals von Philip Morris gekauft wurde. Es existiert zwar nicht mehr, aber die Philip Morris Research Laboratories in Köln gibt es nach wie vor. Ich habe die Adressen nicht verglichen, aber ich vermute stark, dass es sich hierbei um dasselbe Institut handelt [Adressen sind identisch, Anm. d.Red.]. Zudem erscheinen ständig Anzeigen in der medizinischen Fachpresse für Stellen an diesem Institut.
Dann gibt es Forscher, darunter ganz berühmte Psychologen, die auf ihrer Webseite zugeben, dass sie von Philip Morris bezahlt werden.
In Ihrer Studie taucht ein prominentes Beispiel auf: Professor Dietrich Schmähl, lange Jahre ein hohes Direktoriumsmitglied des Deutschen Krebsforschungszentrums, spielte lange die Gefahren des Passivrauchens herunter. Erst nach seinem Tod übernahm das DKFZ die Vorreiterrolle im Kampf gegen das Rauchen in Deutschland.
Das gilt nicht nur für das Beispiel Professor Schmähls, sondern auch für Präsidenten von medizinischen Fachgesellschaften in unserem Land, die von der Tabakindustrie bezahlt wurden. Sie haben verhindert, dass das Rauchen thematisiert wurde, zum Beispiel soll das in der Lungenheilkunde passiert sein.
Die Medizin in Deutschland ist sehr hierarchisch aufgebaut. Die Tabakindustrie hat natürlich ganz gezielt versucht mit mächtigen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen an der Spitze: Chefärzten, Hochschullehrern, Professoren, Präsidenten von Fachgesellschaften.
Sie fordern einen neuen Ethikkodex. Wissenschaftler sollen keine Gelder der Tabakindustrie mehr annehmen.
Es gibt sehr viele Universitäten in den USA und England, wo solch ein Kodex schon existiert, der ihren Wissenschaftlern verbietet, Gelder oder Vorteile der Tabakindustrie anzunehmen oder mit ihr überhaupt in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Er müsste eigentlich von allen Universitäten und relevanten Fachgesellschaften in Deutschland verabschiedet werden. Dazu gehören auch Institutionen, die Forschung fördern, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Bundesärztekammer muss sich auch Gedanken darüber machen, ob sie nicht in der Berufsordnung für Ärzte ein Verbot ausspricht, mit der Tabakindustrie zusammenzuarbeiten.
Sie wollen auch mehr Transparenz - bei Veröffentlichungen soll angegeben werden, woher die Gelder kommen. Ist das überhaupt machbar?
Journale müssen von ihren Autoren verlangen - und dasselbe gilt für Wissenschaftler in Gremien und Beiräten, oder wenn sie öffentliche Statements über Rauchen und Krebs abgeben - dass sie sagen, wenn sie von der Tabakindustrie bezahlt werden.
Sehen Sie schon Anzeichen der Besserung?
Dass das DKFZ einen Monat vor Veröffentlichung meiner Studie seinen Ethikkodex veröffentlicht hat, hat mich positiv gestimmt. Ja, ich denke, es gibt Besserung. Wir reden hier auch nur von einem Teil der Wissenschaftler. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ein Großteil eine Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie sowieso strikt ablehnen würde.